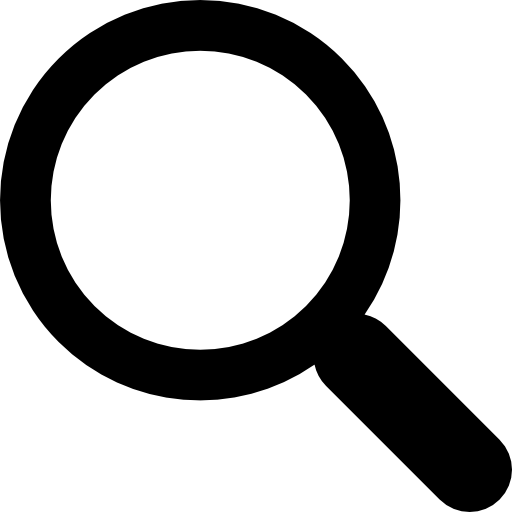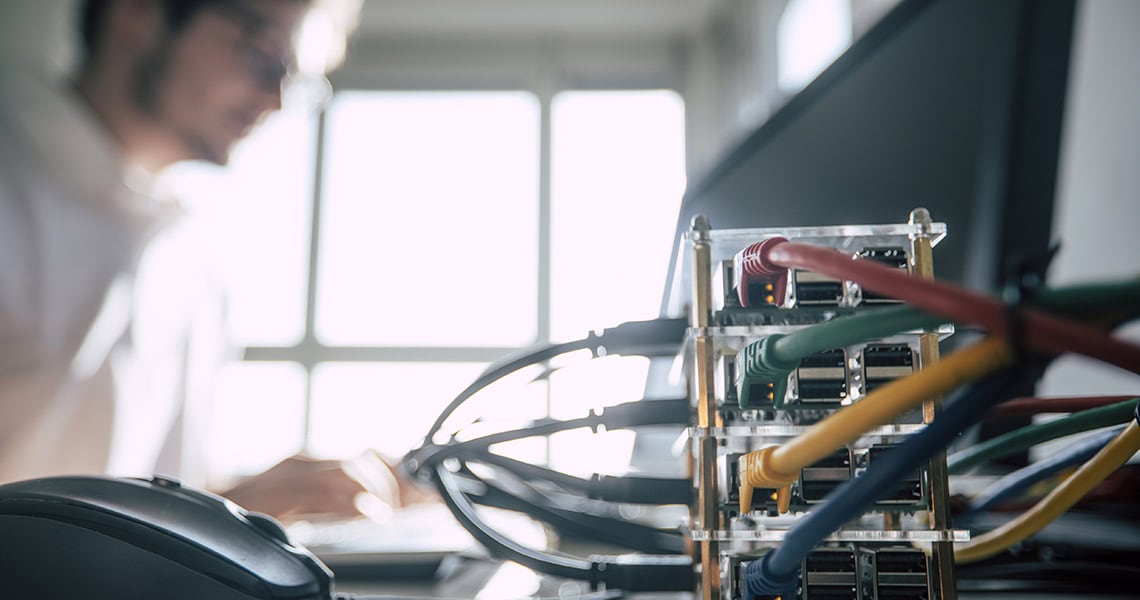Sind wir SAVE_?
Früherkennung von Alzheimer, neue Dimensionen in der Autonomie der Roboter oder Sprachübersetzungen in Echtzeit – Künstliche Intelligenz (KI, AI) hat Potenzial in viele Richtungen. Sie beeinflusst Forschungsarbeit auf vielfältige Weise und eröffnet völlig neue Möglichkeiten, die in atemberaubender Geschwindigkeit Realität werden können. Die beiden AI-Expert*innen Branka Stojanovic und Andreas Windisch von JOANNEUM RESEARCH teilen hier ihre Einschätzungen.
Wie verbessert AI die Effizienz in Forschung und Entwicklung?
Andreas Windisch: Bereits heute lässt sich AI zur Effizienzsteigerung bei Forschungs- und Entwicklungsprozessen gut einsetzen. Zum Beispiel können in der Softwareentwicklung Werkzeuge verwendet werden, die das Coding erheblich beschleunigen. Kleinere Teil- probleme, wie sie in Forschungs- und Entwicklungs- arbeit vorkommen, können mit Hilfe von AI-Systemen schneller und effizienter bearbeitet werden. Ein weite- res Beispiel ist die Möglichkeit, durch AI-Systeme direkt mit wissenschaftlichen Studien zu interagieren. Nach- dem man wissenschaftliche Studien einem AI-Sys- tem „zeigt“, lassen sich die Inhalte abfragen. In diesem Anwendungsbereich gibt es bereits fertig trainierte AI-Systeme, die auf über 200 Millionen veröffentlich- ten Studien trainiert wurden und die darüber detailliert Auskunft geben können.
Wie beeinflusst AI die Innovationsgeschwindigkeit und was sind diesbezüglich die Herausforderungen für ein Forschungsunternehmen wie die JOANNEUM RESEARCH?
Windisch: Als eines der führenden Hochtechnologie- unternehmen in Österreich setzen wir uns mit den neu- esten technologischen Entwicklungen nicht nur auf der Seite der Forschung an sich, sondern auch direkt in den Anwendungen von modernsten Werkzeugen auseinan- der. Diese basieren auch auf generativen AI-Methoden. Dabei gehören das rasche Voranschreiten der Technologie, die Komplexität und die damit einhergehenden Rechenressourcen, aber auch Datenschutz sowie regulatorische und ethische Aspekte zu den Herausforderungen. Dank unserer breiten Kompetenz in diesen Bereichen sind wir gut gewappnet.
Durch AI-Projekte mit Kunden und Industriepartnern, internationale und nationale Forschungsprojekte, durch die Teilnahme an Standardisierungsgremien im Bereich AI, durch Schulungen, Trainings und Vorträge sowie durch die Lehre an Universitäten und Fachhoch- schulen verstehen wir uns als einer der zentralen Kno- tenpunkte der österreichischen AI-Community. Dieses gesamtgesellschaftliche Thema liegt mir sehr am Herzen und ich lade alle ein, die sich dafür interessieren, mit uns in den Diskurs zu treten.
Branka Stojanovic: Künstliche Intelligenz fungiert als Katalysator für Innovationen in der interdisziplinären Forschung an digitalen Technologien. Sie automatisiert Aufgaben, beschleunigt Entscheidungsprozesse und vereinfacht prädiktive Analysen, was die Effizienz steigert. Gleichzeitig ergeben sich daraus Herausforderun- gen: Datenschutz, ethische Fragen, das Schließen von Qualifikationslücken, die Bewältigung komplexer Inte- gration und die Beachtung rechtlicher Rahmenbedingungen. Forschungseinrichtungen wie die JOANNEUM RESEARCH stehen vor den anspruchsvollen Aufgaben, diese Herausforderungen zu meistern, Grundlagenforschung zugänglich zu machen und das Vertrauen in die Technologie zu stärken.
Welche Rolle spielt AI bei der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit?
Stojanovic: Künstliche Intelligenz fördert die Wettbewerbsfähigkeit in der Forschung und auf digitalen Technologiemärkten. Und zwar deswegen, weil sie die Innovationszyklen beschleunigt, die Datenanalyse automatisiert und die Zufriedenheit der Endnutzer*innen verbessert. Dank ihrer Fähigkeit, Muster zu erkennen, Trends vorherzusagen und die Entscheidungsfindung zu verbessern, können Forschende in sich schnell entwickelnden Bereichen zukunftsweisende Spitzenleistungen bringen. Zudem sorgt AI für kontinuierliche Relevanz, Effizienz und bahnbrechende Neuerungen in der dynamischen digitalen Landschaft.
Wer sollte sich mit AI beschäftigen und wieso?
Windisch: Diese Frage ist leicht beantwortet: Alle sollten sich mit dem Thema auseinandersetzen. AI ist ein gesellschaftliches Querschnittsthema, das bereits in vielen Bereichen weit in unseren Alltag eingreift. Daher ist es wichtig, sich mit der Technologie auseinanderzusetzen, um einerseits mögliche Auswirkungen besser einschätzen zu können, andererseits aber auch, um die Technologie für sich selbst optimal nutzbar zu machen.
Wird F&E ohne AI überhaupt noch möglich sein?
Stojanovic: Natürlich sind Forschung und Entwicklung auch ohne AI möglich, in der Vergangenheit sind ja auch bedeutende Fortschritte ohne AI-Technologien erzielt worden. Die Integration von AI in Forschungspro- zesse kann jedoch die Effizienz steigern, die Datenana- lyse beschleunigen und neue Erkenntnisse liefern. Kurz gesagt, sie ist ein mächtiges Werkzeug. Der Verzicht auf ihren Einsatz bedeutet lediglich, dass man sich auf alternative Methoden und Technologien verlassen muss. Die Methodenwahl hängt von den spezifischen Anforderungen, Zielen und verfügbaren Ressourcen eines Projekts ab. Angesichts der Annehmlichkeiten, die AI bietet, stellt sich jedoch die Frage, ob irgendjemand in Zukunft darauf verzichten will.
Fluch oder Segen: Ist AI ein zweischneidiges Schwert im Bereich der Cybersicherheit?
Stojanovic: Definitv. Einerseits lassen sich Bedro- hungen rasch aufspüren und die Reaktionen darauf automatisiert ausgeben. Das verbessert die allgemei- ne Sicherheit. Andererseits bietet künstliche Intelligenz böswilligen Akteur*innen ein großes Spielfeld für Cyberangriffe. Die Herausforderung besteht darin, mit einem verantwortungsvollen Einsatz von AI, robusten und ausgeklügelten Verteidigungsstrategien sowie ethi- schen Überlegungen vorausschauend zu agieren, um so sicherzustellen, dass AI im Bereich der Cybersicher- heit ein Segen und kein Fluch ist. Dies unterstreicht einmal mehr die Bedeutung der angewandten Forschung und der Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation und Wider-standsfähigkeit gegenüber sich entwickelnden Herausforderungen.
DIGITAL ist Teil des EU-Projekts ResilMesh, ein Projekt, das AI einsetzen wird, um Cyber-Bedrohungen zu begegnen. Mit welcher Expertise trägt DIGITAL zu dem Projekt bei?
Stojanovic: ResilMesh, ein EU-Projekt mit einer Laufzeit von 3 Jahren, konzentriert sich auf die Entwicklung eines innovativen Sicherheits-Toolsets. Es basiert auf einem Cyber-Lagebewusstsein und nimmt sich der Herausforderungen der vorherrschenden dispersiven und vielfältigen Cybersicherheitslandschaft an. Als wichtiger Partner in dem Projekt konzentrieren wir uns auf den Einsatz modernster AI, um Bedrohungen aus dem Cyberspace aufzuspüren. Wir setzen dabei AI sowohl in IT- als auch in OT-Umgebungen (Operatio- nal Technology) innerhalb industrieller Kontrollsysteme ein. Darüber hinaus entwickeln wir bei DIGITAL ein Tool, das modernste Reinforcement-Learning-Techniken zur Automatisierung von Sicherheitstests in diesen dyna- mischen Umgebungen einsetzt. Wir sind stolz darauf, Teil einer Initiative zu sein, die die Grenzen der Innovation und Forschung im Bereich der Cybersicherheit neu steckt.
Lassen sich Cyber-Attacken mit State-of-the-Art- Technologie voraussagen oder braucht es dafür Quantencomputer?
Windisch: Quantencomputer sind eine sehr spannende Technologie, mit der wir uns aus unterschiedlichen Blickwinkeln bei JOANNEUM RESEARCH befassen. Quantencomputer befinden sich insgesamt noch in einem relativ frühen Entwicklungsstadium. Ein mögliches Zukunftsszenario wäre, dass Quantencomputer kryptographische Protokolle, also Verschlüsselungsverfahren, angreifbar machen könnten. Hier wird bereits intensiv an neuen Verfahren gearbeitet, die auch durch Quantumcomputing nicht gefährdet sind. Umgekehrt gibt es auch Szenarien, in denen Quantumcomputing Cybersecurity unterstützen kann, wie zum Beispiel durch das Herstellen abhörsicherer Kommunikationskanäle zum sicheren Austausch kryptographischer Schlüssel zwi- schen zwei Parteien.
Stojanovic: Da moderne AI-Technologien erhebliche Fortschritte bei der Vorhersage und Eindämmung von Cyberangriffen gemacht haben, besteht dafür nicht unbedingt die Notwendigkeit für den Einsatz vielversprechender Quantencomputer. Derzeit basieren die Initiativen zur Vorhersage und Vorbeugung von Cyberangriffen auf den Grundlagen der konventionellen Datenverarbeitung und moderner AI-Technologien und nicht auf Quanteninformatik.
Sollten KI-Entscheidungsgremien multidisziplinär besetzt sein?
Windisch: Nachdem AI in alle Gesellschaftsbereiche hineinspielt, gibt es neben den ausschließlich technischen viele weitere Aspekte, die in Entscheidungsprozesse in Bezug auf AI einfließen sollten. Diese umfassen alle Lebensbereiche und fachlichen Disziplinen: von rechtlichen und ethischen Perspektiven, über sozialwissenschaftliche Standpunkte bis hin zu ökonomischen und ökologischen Überlegungen. Eben aus diesem Grund sollten sich mündige Bürger*innen mit dem Thema auseinandersetzen und ihre jeweilige Perspektive einbringen. Nur gemeinsam können wir die Technologie zum Wohle aller nutzbar machen.
Stojanovic: Die AI-Technologie ist mehr als ein Werk- zeug. Sie hat einen großen Einfluss auf den Alltag vieler Menschen. Ein Beispiel wäre die medizinische Beratung. Multidisziplinäre AI-Entscheidungsgremien sind uner- lässlich für einen ganzheitlichen Ansatz zur Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen der künstlichen Intelligenz. Indem sie Fachwissen aus verschiedenen Be- reichen wie Ethik, Recht, Psychologie und Technologie zusammenführen, können diese Teams ein umfassen- deres Verständnis der technischen, ethischen und gesellschaftlichen Auswirkungen der AI gewährleisten.
Die AI-Forschung hat 2023 wichtige ethische und gesellschaftliche Fragen aufgeworfen, insbesondere in Hinblick auf Datenschutz, Autonomie und die soziale Gerechtigkeit. Sehen Sie in Bezug auf Ethik Gefahren bei der Verwendung von AI?
Windisch: AI birgt definitiv viele Gefahren und Potenzial zum missbräuchlichen Einsatz. Gerade aber in Europa, wo wir uns das Hochhalten der Menschenrechte auf die Fahnen geheftet haben, sind wir ganz beson- ders bedacht darauf, die Technologie zum Vorteil der Bürger*innen einzusetzen. Das bedingt auch, dass wir für europäische AI-Systeme Lösungen finden müssen, wie wir mit ethischen Herausforderungen – oder allgemeiner – mit möglicherweise nachteiligen Auswirkungen für den Menschen, umgehen. Hier hat sich auch das Feld des „Digitalen Humanismus“ herausgebildet, das sich mit den technischen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf den Menschen unter den Gesichts- punkten der Menschenrechte, demokratischer Werte und einem diversen Gesellschaftsbild befasst.
Gibt es etwas, das AI niemals können wird?
Windisch: Hier gibt es eine Reihe an Limitationen, die angeführt werden könnten, aber ich entscheide mich für folgende Antwort: AI-Systeme, so wie sie heute ge- artet sind und so wie sie sich in absehbarer Zeit wohl entwickeln werden, sind nicht in der Lage, aus Eigeninteresse nach Antworten zu streben. Diese Neugier, die wir in jedem Kind beobachten können und die uns leider im Erwachsenenalter viel zu schnell abhandenkommt, macht uns zutiefst menschlich. Sie ist der Grund für viele große und kreative Errungenschaften der Menschheit in Kunst, Kultur und Wissenschaft. Dennoch formuliere ich das hier sehr vorsichtig, denn die wirklich harten Limits sind die Grenzen, die durch die Naturgesetze gegeben sind. Daher sind kategorische Aussagen innerhalb dieser Grenzen, gerade im Licht der jüngsten Entwicklungen, mit Vorsicht zu tätigen.
Stojanovic: Letztes Jahr hätte ich gesagt, AI kann nie- mals eine hausgemachte Mahlzeit zubereiten. Heute experimentiert man mit Roboterarmen, die in AI-gesteuerten Küchen mixen, schlagen und schneiden. Heute sage ich: Wir haben eine aufregende Reise vor uns. Bleiben wir ruhig und wachsam. Übernehmen wir Verantwortung. Denn künstliche Intelligenz kann nicht zur Rechenschaft gezogen werden.